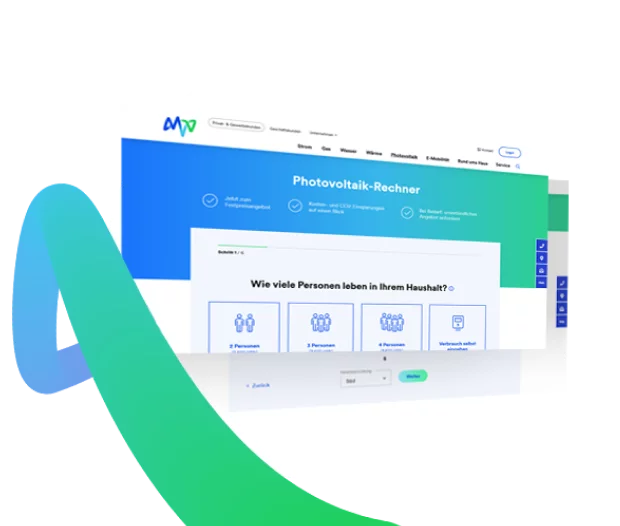Solarpaket 1
Photovoltaik in Mehrparteienhäusern - Neue Möglichkeit zur Nutzung
Die Installation von PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern war bisher mit einigen Hürden verbunden. Seit Inkrafttreten des Solarpakets 1 gibt es nun eine neue Option, die es Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) deutlich einfacher macht: die sogenannte „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“. Lesen Sie hier, wie Sie auch als Hausgemeinschaft unkompliziert Strom vom eigenen Dach nutzen können.

Warum wurde das Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung eingeführt?
Dass eine PV-Anlage in den allermeisten Fällen wirtschaftlich attraktiv ist, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. In manchen Wohngegenden sieht man deshalb kaum noch Einfamilienhäuser ohne Solarmodule auf dem Dach. Anders sieht es dagegen bei Mehrfamilienhäusern aus: oft nur blanke Ziegel auf den Dächern – selbst bei bester Süd- oder Ost-/West-Ausrichtung und optimalem Neigungswinkel. Der Grund: Lange Zeit war die Verteilung von Solarstrom an mehrere Wohneinheiten mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden.
Bislang gab es nur das sogenannte Mieterstrom-Modell, bei dem der Vermieter den Solarstrom an die Mieter verkauft und darüber hinaus auch für die Belieferung mit ergänzendem Netzstrom verantwortlich ist; sprich: der Gebäudeeigentümer wird zum Stromversorger mit einigen damit verbundenen Pflichten. Dies kann für größere Wohnobjekte mit einem alleinigen Eigentümer interessant sein. Für Eigentümergemeinschaften ist das Mieterstrom-Modell jedoch kaum praktikabel. Um die Nutzung von Photovoltaik in Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eigentümern attraktiver zu machen, musste also eine neue, einfachere Lösung her: die „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“, die seit Inkrafttreten des Solarpakets 1 im Mai 2024 per Gesetz geregelt ist.
Wie funktioniert die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung?
Das Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ermöglicht es Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs), sich ohne komplexe Vorgaben oder Verpflichtungen mit Solarstrom zu versorgen. Jede teilnehmende Wohneinheit erwirbt Anteile an einer gemeinschaftlichen PV-Anlage und wird dann ihren Anteilen entsprechend mit Solarstrom versorgt. Den Zukauf von Netzstrom regelt jede Wohnpartei selbst – über einen üblichen Reststromvertrag mit einem individuell wählbaren Stromversorger. Die gerechte Verteilung des selbst erzeugten Stroms erfolgt über ein Smart-Meter-System, das viertelstündlich den gesamten verfügbaren Solarstrom sowie die verbrauchte Strommenge pro Wohneinheit erfasst. Darauf basierend werden die Verbräuche der Haushalte mit dem ihnen zustehenden PV-Stromanteilen verrechnet. Eigentümer:innen, die ihre Wohnung selbst bewohnen, nutzen ihren Solarstrom selbst und reduzieren so ihre Kosten. Vermietende Wohnungseigentümer:innen können ihren Solarstromanteil zu einem fair bemessenen Preis an die Mieter:innen weiterverkaufen; die Stromrechnung vom Energieversorger fällt für die Mieter:innen dann entsprechend geringer aus.
Übrigens: Auch Mehrfamilienhäuser, die einem Eigentümer allein gehören und/oder teilweise gewerblich genutzt werden, können eine PV-Anlage nach dem Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung betreiben.
Umsetzung: Schritt für Schritt zur gemeinschaftlichen Solaranlage
Startschuss – gemeinschaftlicher Beschluss und Erwerb: Wenn sich die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) einig ist, dass ein gemeinsames Interesse an einer PV-Anlage besteht, wird zunächst die Machbarkeit geprüft und es werden Angebote eingeholt. Nach einer Beschlussfassung der WEG erwerben dann alle teilnehmenden Eigentümer:innen Anteile an der Solaranlage. Die Installation ist auch dann möglich, wenn nicht alle Parteien mitmachen. Wer kein Interesse an Solarstrom hat oder die Investition scheut, muss sich nicht an den Kosten beteiligen und bezieht seinen Strom dann einfach weiterhin komplett aus dem Netz.
Gebäudestromliefervertrag – Festlegen der Details:Nach der Beschlussfassung setzen die teilnehmenden Parteien einen Gebäudestromliefervertrag auf. Darin werden zum Beispiel Regelungen zum Betrieb und zur Wartung der Solaranlage festgehalten. Ein wichtiger Bestandteil ist der Aufteilungsschlüssel für die Verteilung des Solarstroms an die einzelnen Nutzer.
Aufteilungsschlüssel – statisch oder dynamisch: Die Verteilung des Solarstroms wird durch einen vertraglich festgelegten Schlüssel geregelt, der dem Netzbetreiber mitgeteilt wird. Dabei kommen grundsätzlich zwei Modelle in Frage: die statische oder die dynamische Aufteilung.
Bei einem statischen Schlüssel bekommt jede Wohnung einen konstanten Prozentsatz des gegenwärtig erzeugten Solarstroms zugeteilt; jeweils dem eigenen Anteil an der Solaranlage entsprechend und unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch. Dies kann allerdings dazu führen, dass manche Wohnungen ihren Anteil zeitweise nicht vollständig nutzen und der Überschuss ins Netz eingespeist wird, während andere Wohnungen mehr verbrauchen und Netzstrom zukaufen müssen, obwohl genügend Solarstrom für den Gesamtverbrauch im Haus produziert wird. Der Vorteil eines statischen Schlüssels ist die sehr einfache Verteilung und Verrechenbarkeit des Solarstroms.
Der dynamische Schlüssel passt die Solarstromverteilung dagegen laufend an die aktuellen Verbräuche an, was auf das gesamte Gebäude bezogen zu einer höheren Eigenverbrauchsquote und damit zu mehr Wirtschaftlichkeit führt. Aus diesem Grund ist eine dynamische Aufteilung generell die bessere Wahl – auch wenn die faire interne Verrechnung des Stroms etwas komplizierter sein kann. Eine häufig gewählte Lösung ist, dass ein hausinterner Solarstrompreis vereinbart wird – zum Beispiel 20 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Zu diesem Preis zahlt jeder Haushalt gemäß seines Solarstromverbrauchs auf ein gemeinschaftliches Konto ein. Am Jahresende wird der angesammelte Betrag dann den Anteilen an der PV-Anlage entsprechend an die Eigentümer:innen ausgezahlt.
Messung über ein Smart-Meter-Netzwerk: Damit die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mit Solarstrom möglich ist, muss an der PV-Anlage sowie in jeder teilnehmenden Wohneinheit ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) installiert werden. Die Smart Meter erfassen alle 15 Minuten die Stromerzeugung sowie die individuellen Verbräuche der Haushalte. Nur so kann die produzierte Strommenge gemäß Aufteilungsschlüssel korrekt verteilt und abgerechnet werden.
Versorgung mit Reststrom und Einspeisevergütung: Falls der verfügbare Solarstrom mal nicht ausreicht, bezieht jede Wohneinheit den Reststrom individuell von ihrem regulären Energieversorger. Überschüssiger Solarstrom wird ins Netz eingespeist und nach Aufteilungsschlüssel vergütet. Bei einem statischen Schlüssel wird die Einspeisevergütung an jede Wohneinheit direkt gezahlt; bei einem dynamischen Modell fließt sie meistens auf ein gemeinschaftliches Konto.
Gibt es weitere praktikable PV-Optionen für Eigentümergemeinschaften?
Neben der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und dem eingangs erwähnten, für WEGs eher ungeeigneten Mieterstrom-Modell gäbe es auch die Möglichkeit, dass jede Wohneinheit eine eigene separate PV-Anlage betreibt. Allerdings ist die Installation mehrerer kleiner Anlagen technisch umständlich und daher wirtschaftlich oft nicht attraktiv. Darüber hinaus kann das Dach eines Mehrfamilienhauses auch an einen Solaranlagenbetreiber verpachtet werden. Dadurch erhält die Hausgemeinschaft eine monatliche Vergütung, ohne dass ihr Investitions- oder sonstige Kosten entstehen. Allerdings kommt dann auch nichts von dem Solarstrom im Haus selbst an – was bedeutet, dass jede Wohneinheit weiterhin zu 100% Netzstrom beziehen muss.
Fazit
Mit der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung wurde ein Modell geschaffen, das es auch Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) möglich macht, unkompliziert eine PV-Anlage zu betreiben. Alle teilnehmenden Eigentümer:innen erwerben Anteile und werden mit Solarstrom versorgt bzw. erhalten eine Vergütung für den ihnen zustehenden Solarstrom. Für die Verteilung und Verrechnung muss die WEG einen Aufteilungsschlüssel vereinbaren. Generell wird zu einem dynamischen Schlüssel geraten, der den PV-Strom zu jeder Zeit so verteilt, wie er aktuell verbraucht wird.
Sie haben Fragen? Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Vorhaben.