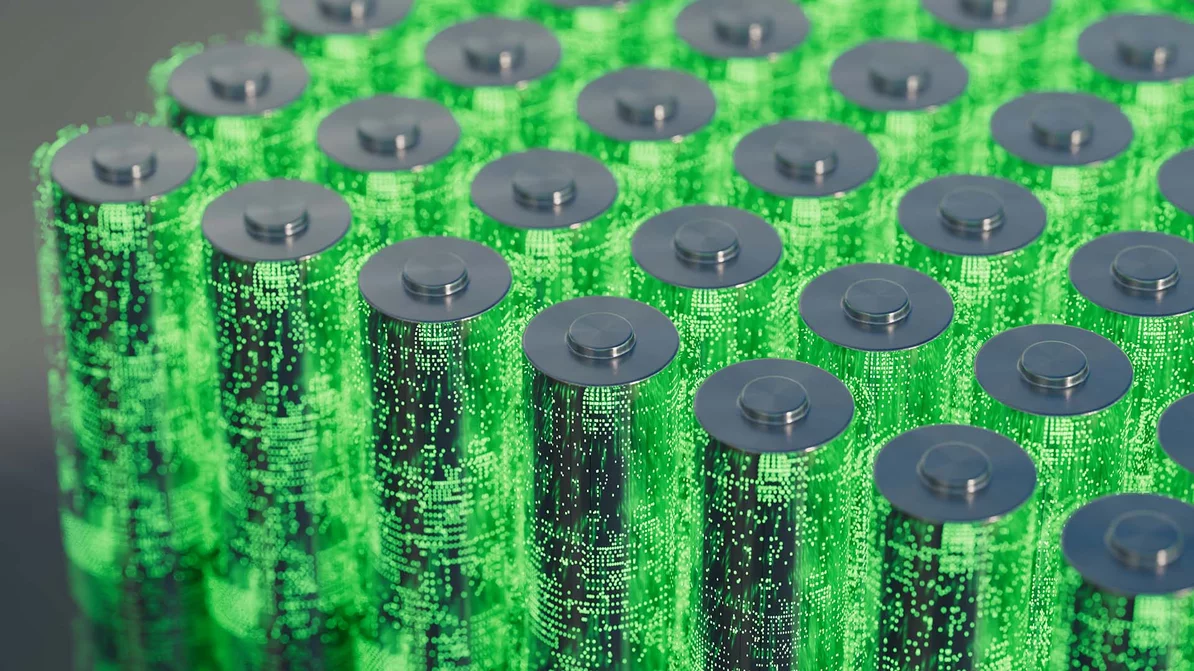Meilensteine der E-Mobilität
Die Geschichte des E-Autos
E-Mobilität ist aus unserem Alltag heute nicht mehr wegzudenken. Trotz berechtigter Kritik an einzelnen Aspekten. Spannend in dem Zusammenhang: Die Geschichte des Automobils begann an sich mit dem elektrischen Fahren. Wir rekapitulieren die Meilensteine der Entwicklung.

Das erste Auto war ein E-Auto
Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der großen Erfindungen und die Elektrizität war eines der spannendsten Themen. Überall auf der Welt, in Europa und Übersee, entwickelten einfallsreiche Menschen an Maschinen, die das Leben grundsätzlich einfacher machen sollten. Der Elektromotor war einer dieser Ideen und die Vorrausetzung dafür, dass an E-Autos überhaupt gedacht werden konnte.
1837 erhielt der Amerikaner Thomas Davenport das erste Patent auf einen Elektromotor. Vermutlich ohne davon zu wissen, erfand der Deutsche Moritz Herman Jacobi nur ein Jahr später einen 300-Watt-Antrieb, der in der Lage war, ein mit 14 Personen besetztes Boot über einen Fluss zu bringen. Als industriell nutzbarer Antrieb hatte der Elektromotor allerdings einen Nachteil, der uns noch heute bekannt vorkommt. Im Vergleich mit den populären Dampfmaschinen war er um den Faktor 25 teurer. Trotzdem wurde unermüdlich geforscht, probiert und produziert.
Der Brite Thomas Parker soll es dann gewesen sein, der 1884 mit einem E-Fahrzeug, als Erster auf den Straßen auftauchte – 4 Jahre vor der ersten Ausfahrt von Berta Benz. Parker hatte alles an seinem Auto selbst entwickelt: die Batterien, den E-Motor, das Fahrwerk. Zugleich war er der erste Nutzer seiner Erfindung, denn er gebrauchte sie als täglichen Dienstwagen auf der Fahrt zu seiner Firma. Übertrieben hastig ging es nicht voran: der „Speed“ von 2 Meilen pro Stunde entspricht dem, was wir als Schrittgeschwindigkeit bezeichnen. Aber: das erste Auto war ein E-Auto.
In der Folge bogen an vielen Orten Prototypen um die Ecke. So auch in Coburg, wo Andreas Flocken um 1888 neben dem ersten deutschen E-Auto auch die Spurstange erfand, wesentliches Element für die Entwicklung einer zuverlässigen Lenkung vierrädriger Fahrzeuge. Der Flockenwagen soll übrigens schon bis zu 15 km/h schnell gewesen sein.
Was für das E-Auto sprach
Im Wettbewerb mit den ersten Verbrennern hatten die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge einige Vorteile zu bieten: Sie qualmten nicht, waren leise und auch einfacher in der Bedienung. So mussten sie nicht umständlich angekurbelt werden, sondern waren „auf Knopfdruck“ einsatzbereit. Dieser Vorteil sorgte dafür, dass an einigen Orten der Welt ein E-Auto-Boom ausbrach. Vor allem in den USA, in den großen Städten. Detroit Electric und Baker Electric wurden zu großen E-Auto Marken und es gibt einige Kenner, die davon ausgehen, dass allein in New York in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts weit über 10.000 E-Autos durch die Straßen stromerten. Sie sahen zwar aus wie „fahrende Telefonzellen“ (US-Talkstar Jay Leno, der einen Baker Electric in seiner Autosammlung hat), waren aber einfach zu fahren (kein Getriebe), durchaus flott (rund 35 km/h schnell), verfügten über elektrische Lampen und die Reichweite von bis zu 130 km erschien angemessen.
Warum setzte sich das E-Auto nicht durch?
Sicher waren die E-Fahrzeuge jener Tage nicht günstig, sondern eher ein Luxusgut. Aber das waren die Verbrenner damals auch. Bis Henry Ford das Fließband erfand und ab 1913 mit dem T-Modell (20 PS, 2,9 Liter 4-Zylinder Verbrennungsmotor) ein Unter-500-Dollar-Auto anbieten konnte. Das würde heute ca. 16.000 Dollar, also knapp 15.500 EUR entsprechen. Damit wurde das Auto tatsächlich massentauglich. Auch technisch bekam der Verbrenner Rückenwind. Die Erfindung des elektrischen Anlassers machte die umständliche Kurbelei überflüssig, die Motoren wurden stärker, die Fahrzeuge schneller, Tanken war zudem viel schneller als Laden – und günstig war es auch. Die Entdeckung neuer Erdölvorkommen senkte den Energiepreis. Demgegenüber ging bei E-Autos technisch nicht so viel voran, die Batterietechnik war immer noch schwer und im Vergleich ineffizient. Das „Momentum“ wanderte zu den Verbrennern und blieb dort über Jahrzehnte.
Ölkrise – die erste Verbrenner-Krise
Die Ölkrise der frühen 70er-Jahre war der erste Riss in der Erfolgsgeschichte des Automobils mit Verbrennungsmotor. Die Erdöl-produzierenden Länder ließen die Erdöl-verbrauchenden Ländern zappeln, indem sie die Produktion zurückfuhren. Die Sprit-Preise begannen dramatisch zu steigen. Es gab autofreie Sonntage und die Sorge, dass den Tankstellen das Benzin ausgeht. In den Entwicklungsabteilungen der Automobilhersteller fing man an, wieder über alternative Antriebe nachzudenken.
So gab es schon 1976 einen Elektro-Golf als Versuchsfahrzeug. Nachdem die Elektroentwicklung die letzten Jahrzehnte allerdings im Tiefschlaf verbracht hatte, war das Ergebnis nüchtern betrachtet alles andere als eine Versuchung: die Blei-Säure-Batterien erhöhten das Fahrzeuggewicht um 500 kg, das Laden dauerte 12 Stunden und der Gleichstrom Elektromotor unter der Haube erzeugte diskrete 27 PS.
Viel stärker war das, was sich in dieser Zeit in den Köpfen der Menschen entwickelte: ein zunehmendes Bewusstsein für Energie und Umwelt. Zum ersten Mal tauchten Fragen nach Ursache, Wirkung und Sinnhaftigkeit auf. Die Denkfabrik „Club-of-Rome“ lieferte dafür mit dem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ die wissenschaftliche Grundlage. Es sollte allerdings noch weitere Jahrzehnte dauern, bis das Thema E-Auto wieder richtig in den Fokus rückte.
Gegen den Mainstream: Kalifornien
Als in den 1990er Jahren in Kalifornien besonders strenge Gesetze zur Reinhaltung der Luft in Kraft traten, passierte etwas Ungewöhnliches: Der damals größte Hersteller von Verbrennungsfahrzeugen, General Motors, entwickelte ein konsequentes Zero-Emission-Vehicle, den elektrisch angetriebenen EV1. Die Karosserie des EV1 war auf möglichst geringen Luftwiderstand ausgelegt und das sah man ihr an. Der Elektromotor leistete zunächst 102 kW also knapp 140 PS, die Höchstgeschwindigkeit wurde bei 129 km/h abgeregelt, die Reichweite lag zuerst bei etwas über 100 km (Blei-Akkus) und stieg mit der zweiten Serie auf über 200 km (Nickel-Metallhydrid-Akkus). Damals war das State-of-the-Art. Doch so ganz trauten die GM-Manager ihrer Neuentwicklung nicht über den Weg oder waren noch nicht bereit, über den eigenen Schatten zu springen. Der EV1 wurde nur verleast und nach Vertragsende mussten alle Fahrzeuge wieder abgegeben werden. Um das Jahr 2000 verschwand der EV1 wieder aus dem Markt.
E-Auto neu gedacht
Ein Jahr nach dem iPhone 1, also 2008, kreuzte das Start-up-Unternehmen Tesla mit einem elektrisch angetriebenen Sportwagen auf. Der Tesla Roadster sollte die Sichtweise auf das E-Auto verändern. Er wollte zeigen, dass E-Autos richtig Spaß machen. Dafür nahmen die Ingenieure das Chassis des Lotus Elise und pflanzten einen 215 kW/292 PS starken Elektromotor vor die Hinterachse. Der Clou war allerdings das Batterie-Pack. Es bestand aus 6831 Zellen handelsüblicher Lithium-Ionen-Zellen der Größe 18650, die auch für Notebooks verwendet wurden. Das Reloaden der E-Auto-Idee hat deshalb auch viel mit den Innovationen der digitalen Welt zu tun. Der Spaßfaktor des Tesla Roadsters in Zahlen: 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden, Topspeed knapp über 200 km/h, abgeregelt zugunsten einer Reichweite von rund 350 km. Aus der Schublade „Vernünftiges Stadtauto“ war das E-Auto damit ausgebrochen.
Der nächste Tesla, das Modell S, trieb die Idee vom E-Auto wieder auf ein anderes Level: Jetzt stand das Prädikat für eine viertürige Luxuslimousine, mit Batteriegrößen zwischen 70 kWh und 100 kWh, mit Reichweiten bis zu 600 km und E-Motoren, die im Laufe der Zeit 500 PS und mehr entwickelten. Das kann man verrückt nennen. Aber es mag die größte Leistung von Tesla sein, das E-Auto auf dramatische Art emotionalisiert zu haben: von der „rollenden Verzichtserklärung“ zu einem Must-have-Gadget.
Die Welt ändert sich
Für das endgültige Comeback des E-Autos musste allerdings mehr passieren als Tesla. Es bedurfte einer neuen Sicht auf die Welt und ihre globalen Herausforderungen, es musste die Einsicht entwickelt werden, dass Probleme wie CO2-Ausstoß und Klimawandel nicht durch Ignorieren zu lösen sind. Für eine Industrie, die mit langen Vorlaufzeiten arbeitet, musste vielleicht auch ein plakatives Signal hochgehalten werden: Im März 2023 verkündete die EU das Verbrenner-Aus für 2035, es sei denn die Fahrzeuge werden mit klimafreundlichen, synthetischen Kraftstoffen betrieben.
Die Welt der E-Autos ist mittlerweile groß geworden. Im aktuellen Neuwagen-Katalog von Auto Motor und Sport sind 52 Marken aufgelistet, die 350 E-Modelle anbieten. Die E-Antrieb hat viele neue „Player“ ins Spiel gebracht (nicht zuletzt aus China) und viele Traditionsmarken neu aufgestellt. Ihr Produktportfolio ist vielseitiger und spannender geworden. Die Reichweiten steigen und die Batterieentwicklung geht weiter. Kontinuierlich wird die öffentliche Ladeinfrastruktur ausgebaut und mit den neuen E-Modellen sinken auch die Preise für den Einstieg in die Elektromobilität. Das E-Auto ist gekommen, um zu bleiben.
Fazit
Bisher war die Geschichte des Elektroautos eine Achterbahn mit langen Denkpausen. Sie zeigt auch, dass verschiedene Faktoren zusammenspielen müssen, um einer Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. In der Zukunft der Mobilität wird das E-Auto sicher eine tragende Rolle spielen. Sind damit alle Fragen beantwortet? Natürlich nicht. Haben wir genügend Strom, um alle kommenden Fahrzeuge zu versorgen? Ist die Energie, die ins Auto kommt, auch klimafreundlich produziert? Passt die Ladeinfrastruktur zur Nachfrage? Funktioniert das Recycling alter Akkus? Vielleicht stehen wir auch nach 140 Jahre noch am Anfang der Geschichte des E-Autos. Sicher ist: Es lohnt sich, das E-Auto einfach mal kennenzulernen.